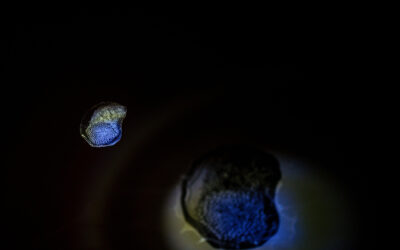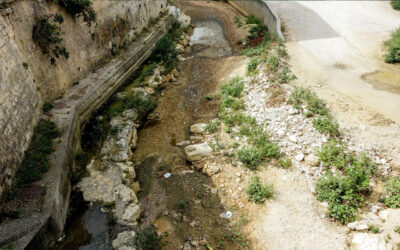Drei wichtige kulturelle Ereignisse fanden in diesem Sommer statt. Zunächst ist die Ruhrtrienale zu nennen. Sie setzte sich kürzlich intensiv mit den Themen Kolonialismus auseinander. Die Aufführung „The head and the load“ von William Kentridge zeigte eindrucksvoll, dass der Kolonialismus noch lange nicht überwunden ist. Auch die Akademie der Künste in Berlin beschäftigte sich intensiv mit dem Thema des kolonialen Erbes. Die Kulturschaffenden, Juristen und Journalisten diskutierten den Kolonialismus. Die Ökonomen waren in Berlin überhaupt nicht vertreten. Schlussendlich hat sich auch die deutsche Regierung beziehungsweise Angela Merkel mit diesem Thema beschäftigt, weil die vor mehr als 100 Jahren geraubten Menschenschädel aus den ehemaligen Deutsch-Südwest-Afrika den Nachfahren aus Namibia übergeben wurden. Die deutschen Militärs begangen vor 114 Jahren einen unbeschreiblichen Völkermord an den Völkern der Herero und der Nama. Deutschland hat sich nach dem Völkerrecht diesen Menschheitsverbrechen nicht gestellt, die Kanzlerin versprach aber den Vertretern aus Namibia Entwicklungshilfe.
Ist das koloniale Erbe nun Schnee von gestern oder muss das Völkerrecht auf den Prüfstand und umgeschrieben werden?
Im Rahmen der Dekolonialisierung des 20. Jahrhunderts wurden viele Kolonien als souveräne Staaten anerkannt. Dies geschah aber keineswegs auf Augenhöhe und die ehemaligen Kolonialstaaten haben defacto keine Souveränität über ihre Ressourcen erhalten. „Konfrontiert mit dem Argument, sie seien in eine Ordnung bereits bestehender, nicht mehr verhandelbarer Verträge und Normen eingetreten, mussten sie sich mit dem Status quo abfinden – und dieser beinhaltete einen national praktisch nicht regulierbaren Zugriff transnationaler Unternehmen auf ihre Ressourcen. Machtpolitisch sahen sie sich konfrontiert mit direkten Eingriffen in innere Angelegenheiten, etwa durch ausländische Geheimdienste bei der Ermordung unliebsamer Politiker im Kongo und Iran, sowie – später – mit massivem Druck, neoliberale Reformen umzusetzen, bezeichnenderweise unter dem Deckmantel der Hilfe zur „Entwicklung““.[1]
Dies hatte zur Folge, dass die Länder des globalen Südens in die Abhängigkeit gedrängt wurden, weil sie beispielsweise die neoliberalen Kreditbedingungen von IWF und Weltbank akzeptieren mussten. Außerdem wurden die Märkte für transnationale Unternehmen sehr weit geöffnet, während die lokalen Bevölkerung um ihre Lebensgrundlagen bangen mussten. Das sogenannte „landgrabbing“ verwehrte der lokalen Bevölkerung zunehmend den Zugang zu Land und Ressourcen.
Der australische Jurist und Professor für Völkerrecht an der University of Utah, Antony Anghie, begreift Kolonialismus nicht als eine Vergangenheit, die überwunden ist, sondern vielmehr als etwas gegenwärtiges, dass eher mit der Zukunft verknüpft ist. Er „verweist auf die zentrale Rolle des Völkerrechts in Prozessen der Kolonialisierung und des Imperialismus und kritisiert die Fortgeltung derjenigen Grundprinzipien, die bereits damals die wirtschaftliche Ausbeutung und Ungleichheit eines Großteils der Bevölkerung im globalen Süden ermöglichten.“[2]
Um die zukünftigen Probleme zu lösen, gehört das reformbedürftige Völkerrecht zwingend in den juristischen Diskurs. Auch die Ökonomie darf sich diesem Thema nicht verschließen. Neoliberale Ökonomen verweisen beim Völkerrecht gerne auf die juristischen Disziplinen und unterstellen, dass die Wirtschaft mit diesem Thema nichts zu tun hat. Wenn es aber um den Freihandel geht, dann werden die Ökonomen laut und verlangen einen uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Ressourcen der Welt. Nach Aussagen des Handelsblattes vom 10.09.2018 zeigt sich der Industrieverband BDI alarmiert über den Zustand der Europäischen Union und fordert den freien Handel, der nach Aussage der deutschen Wirtschaft die Grundlage für den Wohlstand ist. Fraglich ist, wer vom Freihandel profitiert?
Damit an dieser Stelle kein falscher Eindruck entsteht, als Ökonom bin ich natürlich für den Freihandel (siehe auch: Die unsichtbare Hand), wenn er denn auf Augenhöhe geschieht. Dies ist aber keineswegs der Fall, da Landnahme, Krieg und zutiefst ungerechte Verträge über die Souveränität der Ressourcen mit den Ländern des Südens dagegensprechen. Auch wenn der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) den neoliberalen Freihandel umsetzen, gehören der Kolonialismus und das damit verbundene Völkerrecht nicht nur in die juristische Diskussion, sondern auch in den ökonomischen Diskurs. Auch Ökonomen stehen in der Verantwortung und müssen den Begriff des Freihandels dringend überdenken und modifizieren. Im Wesentlichen drückt der Freihandel aus, »dass jede sich irgendwo auf dieser Welt befindende Ressource demjenigen zum Kauf freistehen muss, der das meiste für sie bietet. Mit anderen Worten: Wer immer das Geld hat, um diese Ressource zu kaufen, hat auch einen Rechtsanspruch auf sie. Nach diesen Regeln gehört das Öl Venezuelas ganz genauso den Vereinigten Staaten, als ob es unter dem Boden von Texas oder Missouri läge.«[3]
Die Begriffe Freihandel und auch Freiheit werden in der Ökonomie zunehmend positiv besetzt und deshalb benutzen neoliberale Ökonomen diese Begriffe auch verstärkt. Der Begriff Freihandel ist unverdächtig. Er wird leider selten mit den Begriffen Landnahme, Krieg, Terrorismus und Flüchtlingen in Verbindung gebracht. Wie schon ausgeführt, ist eine entscheidende Fluchtursache die neokoloniale Ausbeutung der afrikanischen Staaten. Global operierende Investoren und einheimische Machthaber betreiben landgrabbing, um sich exportierbare Nahrungsmittel und Bodenschätze anzueignen. Ackerböden lohnen sich für Investoren und Spekulanten doppelt, einerseits kann mit den landwirtschaftlichen Produkten viel Geld verdient werden und andererseits steigt der Wert des knappen Ackerlandes. Finanzinvestoren, die mit der Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun haben, bestimmen zunehmend die agrarische Nutzung. Nach Schätzungen der Welthungerhilfe haben mehr als 30 Millionen Menschen ihr Land und damit ihre Lebensgrundlage verloren. Das Menschenrecht auf Nahrung[4] bleibt auf der Strecke. Die Konkurrenz im Nahrungsmittelsektor erhöht den Druck auf die Kleinbauern und auf die indigenen Gemeinden. Großinvestoren interessieren sich ausschließlich für den Profit[5] und ignorieren die Land- und Gewohnheitsrechte der agrarischen indigenen Bevölkerung. Damit wird den Ländern des Südens die Möglichkeit genommen, die eigene Entwicklung in die Hand zu nehmen.
Das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenlebens wird nachhaltig zerstört, wenn eine Politik ausdrucksvoll auf Abwertung und Entmenschlichung von fremden Kulturen und Flüchtlingen setzt. Es steht zu befürchten, dass sich der Rassismus in Deutschland und in der EU verstärken wird. In solch einem politischen Klima wird dann nicht mehr über die Ausbeutung des globalen Südens gesprochen. Die historische und gegenwärtige Behandlung der Mitschuld westlicher Akteure wird im gesellschaftlichen Diskurs unterschlagen. Letztendlich benötigen wir ein zeitgemäßes Völkerrecht, dass die sogenannten Entwicklungsländer vor fremden Zugriffen schützt und die globalen, ökonomischen und sozialen Ungleichheiten abmildert. Eine ernsthafte Bekämpfung von Fluchtursachen findet dann statt, wenn die fortdauernde Hierarchisierung von Kulturen auf allen Ebenen unterbunden wird.
[1] Wolfgang Kaleck und Karina Theurer, Das Recht der Mächtigen, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe 08/2018, Berlin, S. 109.
[2] Wolfgang Kaleck und Karina Theurer, Das Recht der Mächtigen, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Ausgabe 08/2018, Berlin, S. 109.
[3] Richard Heinberg, Öl – Ende, München, 2008, S. 71.
[4] Nach Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist die Beseitigung von Hunger kein Akt des guten Willens, sondern eine völkerrechtlich bindende Pflicht.
[5] Auch wenn Investitionen prinzipiell unsicher sind, ist an dieser Stelle der Profit sicher, weil einerseits die Weltbevölkerung wächst und die landwirtschaftlichen Flächen schrumpfen, zum Beispiel durch den Klimawandel, der Bodenerosion und der Versiegelung.