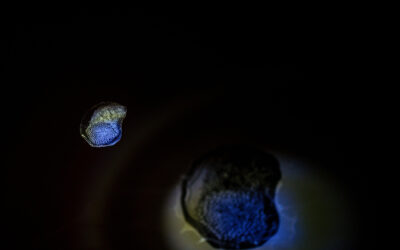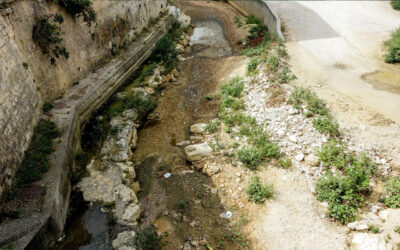„(E)s gibt keine a priori richtige oder falsche Form des Lebens und mithin auch keine a priori bestimmbare Form des guten Lebens und des Glücks.“
(Hartmut Rosa)
Im kürzlich beendeten Wahlkampf ist eines sehr deutlich geworden: Beim Thema Klimawandel wurde von einigen Politikerinnen und Politiker sofort die Arbeitsplatzkeule, gepaart mit einem Bedrohungsszenario, geschwungen. Volker Pispers hat bei derartiger Argumentation häufig folgenden Kommentar losgelassen: Man dürfe den Terrorismus nicht zu stark bekämpfen, sonst gehen Arbeitsplätze in der Dynamitstangenindustrie verloren. Aber Spaß beiseite – es wird Zeit über die Arbeit nachzudenken und sie grundlegend zu reformieren. Es reicht nicht aus, eine Work-Life-Balance anzustreben, zumal diese auch nicht unbedingt erstrebenswert ist.
Arbeiten (Work) und Leben (Life) scheint ein Widerspruch zu sein. Ist leben tatsächlich etwas anderes als arbeiten? Konfuzius meinte bereits vor 2500 Jahren, dass man sich einen passenden Beruf aussuchen solle, damit man nie wieder im Leben arbeiten müsse. Er hätte es nicht für möglich gehalten, dass die moderne Steigerungslogik (Größer, schneller, weiter – aber wohin?) uns zur Abarbeitung von To-do-Listen zwingt. Schließlich werden die Ressourcen nur einmal verteilt und der Konkurrenzdruck steigt, folglich werden die Optimierungsanforderungen größer. Kann unter diesen Voraussetzungen überhaupt ein gutes, arbeitsreiches Leben gelingen, wenn Lebensqualität auf den Warenkonsum reduziert wird?
Die Werbung suggeriert uns, dass eine steigende Anzahl von Glücksmomenten auch ein gutes Leben beinhaltet. Dieses ist offensichtlich falsch. Adorno beschrieb es in einem kurzen Aphorismus (Minima Moralia): „Ob einer glücklich ist, kann er dem Winde anhören. Dieser mahnt den Unglücklichen an die Zerbrechlichkeit seines Hauses und jagt ihn aus leichtem Schlaf und heftigem Traum. Dem Glücklichen singt er das Lied seines Geborgenseins: sein wütendes Pfeifen meldet, daß er keine Macht mehr hat über ihn.“
Konsum, Konsum
Man muss kein Prophet oder Wissenschaftler sein, um die weltweite Konsumsituation zu verstehen; ein Besuch in einem x-beliebigen Shoppingcenter an einem beliebigen Ort reicht vollkommen aus. Wenn man mit wachen Augen durch dieses Center geht, entdeckt man Mode- und Kleiderläden, Schuhgeschäfte, Schmuckboutiquen, Brillen- und Uhrengeschäfte, Bräunungs- und Fitnessstudios, Drogerien, Parfümerien, Apotheken und diverse Bäckereien und Cafe´s. Diese Geschäfte haben eine Gemeinsamkeit, sie beschäftigen sich allesamt mit dem eigenen Körper. Diese Läden finden wir zunehmend in den Innenstädten und Shoppingmals. Der eigene Körper und die Optimierung des Körpers stehen im Mittelpunkt dieser Läden. Der eigene Körper wird deshalb inszeniert, weil er selbst zum Begehrensobjekt stilisiert wird. Der Konsum soll Lebensglück stiften. Dies wird nicht gelingen, weil die unbegrenzten Konsumwünsche, nach den Vorstellungen der Ökonomen, nie erfüllt werden können.
Die Geschäfte, die sich mit der produktiven und sinnvollen Seite des Lebensglücks beschäftigen, verschwinden aus den Städten. Der Verkauf von Bastelbedarf, Handwerkszeuge, Musikinstrumente, Wolle und Bücher scheint, wie auch das intrinsische Interesse, rückläufig zu sein und „(der) eigene Körper wird zu einer zentralen Projektionsfläche für Begehrungen, die sich in dem Wunsch konkretisieren, schlanker, fitter, gesünder, hübscher, brauner, leistungsfähiger usw. zu sein.“[1]
Steigender materieller Konsum schafft weder Glück noch ein gutes Leben. Scheinbar verhält es sich genau umgekehrt – die Glücksmomente nehmen mit zunehmendem Konsum ab. Die Auseinandersetzung mit den „flüchtigen“ Gütern der Welt findet kaum statt. „Unter allen Gegenständen, die wir in der Welt vorfinden und die uns umgeben, besitzen die Konsumgüter den geringsten Grad an Beständigkeit, sie überdauern kaum den Augenblick ihrer Fertigstellung.“[2] Ob Glücksmomente entstehen können, ist nicht abhängig vom Konsum, sondern von dem „Selbst- und Weltverhältnis“ (Hartmut Rosa) eines jeden Menschen. Und hier nimmt nicht der Konsum, sondern die Arbeit eine Schlüsselrolle ein.
Jäger, Hirte, Kritiker
Die berühmten sozialtheoretischen Denker Karl Marx, Georg Simmel und Hannah Arendt haben immer wieder betont, wie wichtig die Arbeit für die Weltbeziehung des Menschen ist. Arbeit ist zentral für das Glück. Durch die Arbeit werden vielfältige Resonanzbeziehungen aufgebaut. Karl Marx hat ausgeführt, dass Arbeit die menschliche Weltbeziehung herausbildet, nämlich die aktive Wechselbeziehung von Mensch und Natur und somit von Subjekt und Objekt. In den „Pariser Manuskripten“ von 1844 diagnostizierte Marx eine grundlegende Störung in der Beziehung des modernen Menschen mit der Welt. Die Verwerfungen lokalisierte er in den Arbeitsbeziehungen, die sich von der aktiven Auseinandersetzung mit der Natur entfernt hat. Die Arbeit sollte aber die Menschen mit der Welt und dem Gemeinwohl verbinden. Arbeit strukturiert den Tag und sie sollte sowohl Zufriedenheit hervorbringen als auch einen gemeinwohlstiftenden Wert haben. Die leistungs- und wachstumsorientierte Arbeit könnte ersetzt werden durch sinn- und glücksstiftende Arbeit. »Heute dies, morgen jenes zu tun; morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.« (Karl Marx)
Was tun?
Wie soll eine sinn- und glücksstiftende Arbeit gelingen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen, gleichzeitig den arbeitsteiligen Anforderungen des Marktes, der durch eine unbarmherzige Konkurrenzlogik geprägt ist, genügen müssen, außerdem vielfältige unternehmerische Risiken tragen und sich als Kostenfaktor begreifen sollen? Die intrinsisch motivierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Glück, weil sie mit ihrer Arbeit in der Regel zufrieden sind. Leider ist aber gerade in diesem Bereich die Selbstausbeutung sehr häufig zu beobachten. Deshalb muss der Produktionsfaktor Arbeit grundsätzlich neu strukturiert werden. Hier sind zwei Lösungsansätze hervorzuheben. Zum einen ist die Arbeit eine Konstante in der Menschheitsgeschichte, weil sie die tätige Aneignung der Natur impliziert. Zum anderen stellt Arbeit ein zivilisatorisches Minimum dar. „Eine Gesellschaft die dieses Minimum nicht mehr anzubieten im Stande ist, verspielt langfristig ihren moralischen Kredit, der für eine einigermaßen friedliche Konfliktregelung der Interessen ihrer Mitglieder unabdingbar ist.“[3]
Die tätige Aneignung der Natur kommt an seine Grenzen. Die jüngste Flutkatastrophe in Deutschland hat eindrücklich gezeigt, dass das Mensch-Natur-Verhältnis in einer existenziellen Krise steckt. Deshalb muss der gezielte Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft die Arbeit ebenfalls nachhaltig reformieren.
Die Arbeit als „zivilisatorisches Minimum“ wurde im Jahr 1982 durch das Versprechen Helmut Kohls – „Leistung muss sich wieder lohnen!“ – verändert und Kohl leitete die „geistig-moralische-Wende“ ein. „Es begann eine Ära, in der die gesellschaftliche Norm der Leistung nachhaltig umgedeutet wurde. Die traditionelle Arbeit*innenschaft hatte bislang einen nicht unwesentlichen Anteil ihrer Würde und ihres Stolzes aus der Tatsache bezogen, dass sie sich als Produzent*in des gesellschaftlichen Reichtums betrachtete.“[4] Das Leistungsprinzip war nicht der primäre Motor der Arbeit, sondern der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung. Der Stolz, etwas zu produzieren, wurde konterkariert und der Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) trieb es 2006 mit seiner Behauptung – „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ – auf die Spitze. Nun wurde der „Produzentenstolz“ der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgekehrt in ein Sanktionssystem und aus der Leistungsgesellschaft wurde eine gnadenlose Konkurrenzgesellschaft.
Diese beiden Problemlagen, nämlich ökologisch nachhaltige Arbeit gepaart mit dem „zivilisatorischen Minimum“, muss zukünftige Politik lösen. Beispielsweise wäre eine Reduktion des Fremdversorgungsgrades ökologisch sinnvoll. Dies bedarf einer Stärkung der Regional- und Selbstversorgung. Die Eigenproduktion lässt sich durch Nutzungsdauerverlängerung und Gemeinschaftsnutzung sinnvoll ergänzen. Dies ruft den „Prosumenten“ (Niko Paech) auf den Plan, eine Kombination aus Konsumenten und Produzenten. „Langlebige, reparable und anpassungsfähige Produktdesigns würden Prosumenten dazu befähigen, mittels handwerklicher Kompetenz, eigenen Zeitinputs und sozialer Vernetzung einen halbierten Industrieoutput so zu >veredeln<, dass auf keine Konsumfunktion verzichtet werden müsste.“[5] Mir scheint hier eine Orientierung zum Prosumenten sinnvoll, denn „(s)ouverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht.“[6] Dann ist auch eine Work-Life-Balance nicht mehr erforderlich, weil sich leben und arbeiten nicht mehr ausschließen, sondern sinnvoll ergänzen.
[1] Hartmut Rosa, Resonanz, Berlin, 2019, S. 209
[2] Hannah Arendt, Vita activa, München, 1967, S. 114
[3] Oskar Negt, Arbeit und menschliche Würde, Göttingen, 2001
[4] Nicole Mayer-Ahuja und Oliver Nachtwey, Leistung, die sich nicht lohnt, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 9´21, Berlin, 2021, S. 113
[5] Erhard Eppler, Niko Paech, Was Sie da vorhaben, wäre ja eine Revolution …, München, 2016, S. 195
[6] Niko Paech, Befreiung vom Überfluss, München, 2012, S. 130