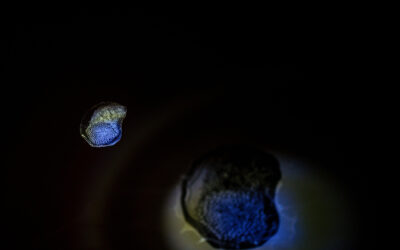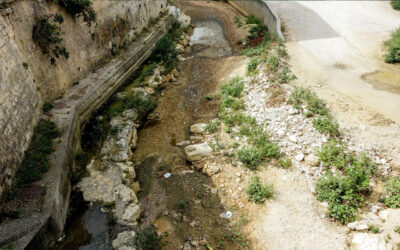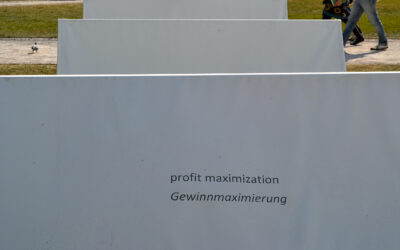„Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“
Bertold Brecht, 1934
Die klassische Theorie geht von der Neutralität des Geldes aus. Sie ist bis heute ein wesentlicher Eckpfeiler der ökonomischen Theorie, und insofern kann man von einem Axiom sprechen, dass keines Beweises und keiner Rechtfertigung bedarf. Es gibt aber keinen empirischen Beweis dafür, dass das Geld tatsächlich neutral ist. Dies wird nur aus modelltheoretischen Erwägungen heraus unterstellt. Keynes war der Auffassung, dass dieses Axiom bestenfalls in einer reinen Tauschwirtschaft Anwendung finden kann. Nach der klassischen Theorie werden Güter und Dienstleistungen gegen andere Güter und Dienstleistungen eingetauscht. Geld wird deshalb nicht benötigt, weil nach dem Say`schen Gesetz (Jean-Baptiste Say, 1767-1832) die angebotenen Güter und Dienstleistungen genau der Nachfrage entspricht.
Corona-Krise und Geldströme
Die Corona-Krise hat es gezeigt, denn die Geldströme waren für eine bestimmte Zeit unterbrochen und somit hat sich die Krise verschärft. Jeder Kaufmann kennt die Binsenwahrheit: Wenn sich Zahlungen nicht nahtlos an andere Zahlungen reihen, müssen sie durch Kredite überbrückt werden. Nach der Theorie von Keynes muss der Staat für diese Kredite einstehen, sonst sorgen die Zahlungsunterbrechungen dafür, dass die Wirtschaft kollabiert, Insolvenzen und Arbeitslosigkeit sind die Folgen. Die Geldströme müssen permanent versorgt werden, einen Moment des innehalten, führt zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft. Dies ist aber kein Naturgesetz, sondern ein diskussionswürdiger Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung.
Keynes erkannte das Axiom der Geldneutralität nicht an und folgerte daraus, dass „Aufschwünge und Rezessionen […] typische Merkmale eines Wirtschaftssystems [sind], in dem […] das Geld nicht neutral ist.“[1] Deshalb beeinflusst das Verfügen über Geld und Liquidität Entscheidungen, die sich letztendlich auf das Beschäftigungs- und Produktionsniveau auswirken.[2] Außerdem lehnte Keynes die klassische Vorstellung vom Sparen ab, „wonach der Sparer ganz genau weiß, zu welchem zukünftigen Zeitpunkt seine Konsumwünsche sein Einkommen übersteigen werden, so dass er zusätzliche Kaufkraft benötigen wird, die er durch Sparen aufbauen muss.“[3] Dies setzt den homo oeconomicus voraus der nicht nur genau weiß, was er tut, sondern dieser ökonomisch handelnder Mensch kann auch noch, wie ein Hellseher, in die Zukunft schauen. Keynes meinte hingegen, dass die Zukunft ungewiss sei und dass deshalb Menschen sparen. Die Ersparnisse dienen dazu, Rücklagen für schlechte Zeiten zu haben. Neben der Versorgung der Geldströme ist auch diese Sichtweise in Corona-Zeiten zu diskutieren. Wie müssen Unternehmen und auch Haushalte beschaffen sein, damit sie auch Krisen überstehen können? Haben wir unsere Konsumwünsche übertrieben? Scheinbar hat die Konsumgesellschaft ihren Höhepunkt längst überschritten, denn man sollte nicht dauerhaft mit wachsendem Konsum rechnen, wenn das Leben auf der Erde gefährdet ist.
Das Karriereende der schwäbischen Hausfrau
Diese Wirtschaftsordnung benötigt scheinbar die Banken und deren Dienstleistungen, sonst würden sich die Räder der Ökonomie nicht drehen. „Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass Zinsen und andere Gebühren, die man den Nutzern von Finanzdienstleistungen abverlangt, einen produktiven „Output“ darstellen. Würden alle Unternehmen ihre geschäftlichen Investitionen über Gewinnrücklagen (den Teil der Profite, der nicht an die Aktionäre geht) finanzieren und alle Haushalte ihre Kosten mit Ersparnissen bestreiten, bräuchte der private Sektor nicht zu borgen. Entsprechend bräuchte auch niemand Zinsen zu zahlen und Darlehen von Banken wären überflüssig.“[4] Diese Sichtweise war vor einigen Jahrzehnten Normalität und wurde im Jahre 2008 durch die Erschaffung der schwäbischen Hausfrau durch Angela Merkel wieder kultiviert. Sie, die schwäbische Hausfrau, ist aber vor einigen Wochen gestorben. Jeder Unternehmer weiß, dass er ständig Kredite aufnehmen muss, um zu investieren. Werthaltige Investitionen schaffen Vermögenswerte. Eine Unternehmung, die nicht investiert, wird vom Markt gefegt. Nach jahrelanger Austeritätspolitik, Schuldenbremse und schwäbischer Hausfrau hat dies auch nun der Staat begriffen, denn er muss Vorleistungen für Unternehmen und Haushalte anbieten. Die Infrastruktur ist auszubauen und Bildungs-, Umwelt- und Klimainvestitionen sichern uns die Zukunft. Der Investitionsstau in Deutschland umfasst mittlerweile mehrere Hundert Milliarden Euro. Jetzt hat uns die Pandemie die Augen geöffnet und wir sind erstaunt darüber, dass wir der schwäbischen Hausfrau bedingungslos gefolgt sind.
Die Finanzwirtschaft wird es nicht richten
Heute dominiert die Finanzwirtschaft die Volkswirtschaft und die Realwirtschaft muss sich zunehmend der Finanzwirtschaft unterordnen. Natürlich benötigen wir eine streng regulierte Finanzwirtschaft in jeder Volkswirtschaft, aber benötigen wir auch sogenannte Finanzmarktprodukte, die keinen Bezug zu irgendeinem ökonomischen Wert haben? Es gibt eine Reihe von, ökonomisch wertlosen, Finanzprodukten, die ausschließlich der Spekulation dienen. Auch dies war eine wesentliche Lehre der Corona-Krise. In den Zeitungen war von Leerverkäufen zu lesen und es wurde munter für oder gegen das Corona-Virus gewettet. Es befinden sich nach wie vor unzählige sogenannte Finanzprodukte auf dem Markt, die keinen Bezug zu ökonomischen Werten haben, weil sie ausschließlich Spekulationsgeschäfte bedienen. Man leiht sich im Rahmen von Leergeschäften Aktien und ist aufgrund dieser Rechtslage Besitzer dieser Aktien. Mit diesen Aktien wird dann gewettet und wenn man Glück hat, können diese Aktien später am Markt günstiger eingekauft werden um sie dann anschließend dem Verleiher zurückzugeben. Dieser Sachverhalt wird auch als „Short-Selling“ bezeichnet, weil der geliehene Vermögenswert nach kurzer Zeit (short) zu einem günstigen Preis zurückgekauft wird. Der so entstandene „Gewinn“ hat hingegen keinen ökonomischen Bezug und ist als leistungslose Rente zu qualifizieren.
Solche Leerverkäufe haben einen rein spekulativen Charakter, deshalb sollte man zwingend über Verbote und Regulierungen nachdenken. Die Akteure de Finanzwirtschaft sind aber gegen regulierende Kontrollen. Hier könnte die schwäbische Hausfrau eine neue Beschäftigung finden, indem sie die Finanzmärkte wesentlich stärker reguliert. Es ist unverantwortlich, dass man die Beurteilung von verantwortbaren Geschäftsmodellen dem Markt überlässt. Dies ist insofern problematisch, weil die Weltökonomie zu 80 Prozent aus „Spekulationsshopping“ besteht.[5] Die Corona-Krise bietet auch hier die Möglichkeit, die Finanzwirtschaft grundlegend neu zu ordnen und beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer einzuführen.
[1] J.M. Keynes, A Monetary Theory of Production, nachgedruckt in: The Collected Writings of John Maynard Keynes, Band 13, London, 1979, S. 408
[2] In Deutschland wurde innerhalb der neoliberalen Wende der „beste Niedriglohnsektor der Welt“ (Gerhard Schröder) geschaffen, sodass die Binnennachfrage rückläufig war. Die Corona-Krise zeigt – dieser Niedriglohnsektor führt zu ökonomischen Verwerfungen und ist deshalb abzuschaffen, weil er das Einfallstor für Erwerbs-, Familien- und Altersarmut darstellt.
[3] Paul Davidson, John Maynard Keynes, Berlin, 2015, S. 62
[4] Mariana Mazzucato, Wie kommt der Wert in die Welt?, Frankfurt / New York, 2018, S. 150
[5] Vgl. Rudolf Hickel, Zerschlagt die Banken, Belin, 2012, S. 39