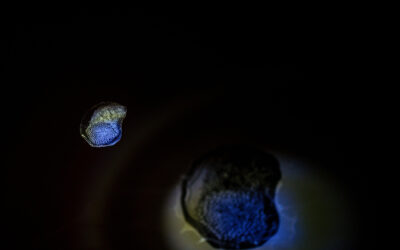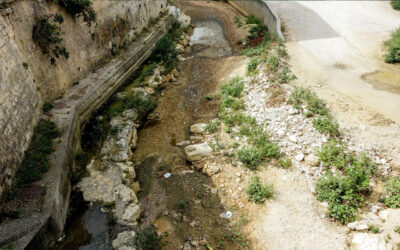All sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them.
Isak Dinesen
Ich gebe es zu- oder gebe ich an – mein Hobby seit frühester Jugend ist das Lesen, später ist das Schreiben hinzugekommen. Im Jahre 1973 habe ich mein erstes Sachbuch gelesen: Die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows, der unter anderem die CO2-Emissionen des Klimaforschers Charles David Keeling aus dem Jahre 1958 untersuchte. Denn Keeling stellte schon 1958 fest, dass die CO2-Konzentration um 1,5 parts per million (ppm) pro Jahr zunimmt. Er vermutete schon damals, dass dieser Anstieg mit der Industrialisierung zusammenhängt. Die Konsequenzen für das Weltklima konnte man im Jahr 1973 nur grob erahnen. Durch die Studien von Dennis Meadows wurde aber klar, dass die Grenzen des Wachstums bald erreicht sein würden. Viele Menschen meiner Generation forderten folgerichtig eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt bezeichnete derartige Gedanken als Utopien und prägte den Spruch: „Wer Utopien hat, sollte zum Arzt gehen“. Hatte Helmut Schmidt recht? Waren unsere Gedanken damals Hirngespinste oder müssen solche Bedenken nochmal überdacht, strukturiert und aufgeschrieben werden?
Patti Smith hat es in ihrem neuen Buch „Hingabe“ gut dargestellt und gefragt: „Welche geheimnisvolle Macht treibt jemanden dazu, das Erlebte, seine Gefühle und Gedanken zu Papier zu bringen?“ Für mich persönlich gibt es nur eine Antwort – das Erlebte, die Gefühle und die Gedanken müssen im Kopf geordnet werden, damit die Urteilskraft durch selbstkritische Reflexionen eine Stärkung erfahren kann. Dies gelingt am besten, wenn man die Gedanken zu Papier bringt. In Anlehnung an Heinrich von Kleist[1] könnte man auch sagen, die Gedanken entstehen allmählich beim Schreiben. Die von mir geschätzte Hannah Arendt hat das in einem Interview mit dem Journalisten Günter Gaus im Jahre 1964 sehr treffend formuliert:
„Gaus: Ihre Arbeit – wir werden auf Einzelheiten sicherlich noch kommen – ist in wichtigen Teilen auf die Erkenntnis der Bedingungen gerichtet, unter denen politisches Handeln und Verhalten zustande kommen. Wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen, oder glauben Sie, dass eine solche Wirkung in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist – oder ist Ihnen ein solcher Breiteneffekt nebensächlich?
Arendt: Wissen Sie, das ist wieder so eine Sache. Wenn ich ganz ehrlich sprechen soll, dann muss ich sagen: Wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert.
Gaus: Und wenn die Arbeit fertig ist?
Arendt: Ja, dann bin ich damit fertig. Wissen Sie, wesentlich ist für mich: Ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist Teil in dem Verstehensprozess.
Gaus: Wenn Sie schreiben, so dient es Ihrem eigenen, weiteren Erkennen?
Arendt: Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt: Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich irgendetwas notiert hätte. Worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, es im Schreiben adäquat auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. – Jetzt fragen Sie nach der Wirkung. Es ist das – wenn ich ironisch werden darf – eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken; aber ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe – dann gibt mir das eine Befriedigung, wie ein Heimatgefühl.“[2]
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Hannah Arendt hat auf einem sehr hohen Niveau geschrieben. Einige ihrer Schriften haben mich an den Rand der Verzweiflung getrieben, weil ich sehr wenig verstanden habe. Mit wiederholtem Lesen wurden mir Hannah Arendts Gedanken aber immer vertrauter und meine persönliche Zufriedenheit nahm nachhaltig zu. Diese Zufriedenheit lässt sich mit kurzlebigem Konsum niemals erreichen.
Es geht beim Schreiben aber auch nicht darum, ein hohes Niveau zu erreichen. Die Außenwirkung ist auch relativ belanglos, man will sich ja nicht wie eine Ware verkaufen. Es geht beim Schreiben, wie Hannah Arendt betonte, nur um das Verstehen, um die Erkenntnis und um das Ausloten von Alternativen. Das Unwort des Jahres 2010, nämlich „alternativlos“ gehört ersatzlos gestrichen. Es gibt (fast) immer Alternativen. Der Mensch hat nach Kant eine Sonderstellung in der Natur, weil er in Alternativen denken kann und sich somit nicht einem Schicksal ergeben muss. Das genaue Gegenteil von Politik ist Schicksal. Wir sind aber keine Schicksalsgemeinschaft, die Klimawandel und Digitalisierung ertragen muss; deshalb ist unser Denken auch immer politisch, weil Alternativen reflektiert werden. Beim Schreiben werden unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte beleuchtet und man stellt fest, dass die politische Urteilskraft zunehmend gestärkt wird. Diese Urteilskraft bedarf eines „gegenständlichen und öffentlichen Betätigungsfeldes (…), um nicht in die Nischen privatisierter und unverbindlicher Kritik zurückzufallen; diese Seite der Urteilskraft hat insbesondere in Zeiten brennende Aktualität, die sich durch eine Art Privatisierungswahn auszeichnen. Wo jeder öffentliche Platz und jede verfügbare Minute von Verwertungsinteressen bedroht ist, schrumpfen Räume und Zeiten, die den Menschen ein zwangloses oder auch bewusst geplantes Zusammentreffen für kollektiven Austausch erlauben.“[3]
In der Bibel steht: „Im Anfang steht das Wort“. Dies ist keine Kleinigkeit, sondern erlaubt weitreichende Assoziationen. Worte müssen glaubwürdig sein. Die Begriffe Worthalten und Wortbruch scheinen in der heutigen Gesellschaft ihre Bedeutung zu verlieren. In vielen Bereichen des Lebens ist die Glaubwürdigkeit des Wortes verloren gegangen, und die moralische Haftung für das Gesprochenen und das Geschriebene scheint rückläufig zu sein. Fake News sind auf dem Vormarsch und die normative Kraft des Faktischen wird durch die Fakten ersetzende Kraft des Phraseologischen substituiert. Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Ein anderer Teil der Wahrheit ist, dass die Schülerinnen und Schüler der friday for future-Bewegung die wissenschaftlichen Belege des Klimawandels nutzen, um ihre Zukunft berechtigterweise einzuklagen. Die Schülerinnen und Schüler beziehen sich auf die Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Worte der Klimaforscher. Recht so.
In den 1970 er Jahren wurde die Mainstream-Ökonomie von weiten Teilen der Gesellschaft als realistisch angesehen, während die „unrealistischen“ Wachstumskritiker eher belächelt wurden. Heute hat es sich komplett ins Gegenteil gedreht. Die friday for future-Bewegung ist realistisch, weil sie sich auf die wissenschaftlichen Ergebnisse zum Klimawandel bezieht, wissenschaftlich begründete Fragen stellt und nicht auf die Verniedlichung des Klimawandels durch Marketing und PR hereinfällt. Ein Großteil der Erwachsenenwelt hingegen verhält sich wie ein Haufen verhätschelter Kleinkinder, die nach der Flasche schreien und von der Utopie einer unbeschränkten SUV-Mobilität ohne Tempolimit und einem grenzenlosen Wirtschaftswachstum träumen.
Die Glaubwürdigkeit des Wortes ist ein schwieriges Unterfangen. Manchmal hört man in der Öffentlichkeit den Spruch, den man Konrad Adenauer zuschreibt: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ War nun Adenauer unverbindlich und unglaubwürdig, mit Sicherheit nicht. Leider wird er an dieser Stelle sehr häufig falsch zitiert. Es gibt keinen Nachweis darüber, ob dieser Spruch tatsächlich so formuliert wurde. Es gibt aber den Nachweis, dass er sinngemäß folgendes zum Ausdruck bringen wollte: „Es kann mich doch niemand daran hindern, jeden Tag klüger zu werden.“ Und da hat der alte Bundeskanzler natürlich recht. Die politische Urteilskraft muss ständig, bis in das hohe Alter, erweitert werden, indem man kritisch reflektierte Sachverhalte in den eigenen Lebenszusammenhang stellt. Denn es gibt noch unverkäufliche Bildung, die nicht gewerbsmäßig und marktkonform betrieben wird. Dazu gehören, in einer kritischen Zivilgesellschaft, unter anderem das Schreiben und natürlich die freien Gedanken, die zum Glück keinen Preis und keinen Markt haben. Karl Marx meinte schon im Jahre 1842: „Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein.” [4]
[1] Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden.
[2] Dies ist nur ein kurzer Auszug aus einem Fernsehinterview der ARD vom 28.10.1964. Es lohnt sich, dass gesamte Interview, dass über 80 Minuten dauert, zu verfolgen.
[3] Oskar Negt, Der politische Mensch, Göttingen, 2010, S. 278.
[4] Rheinische Zeitung” Nr. 139 vom 19. Mai 1842, zitiert nach: Marx/Engels, Werke, Bd. 1, S. 71.