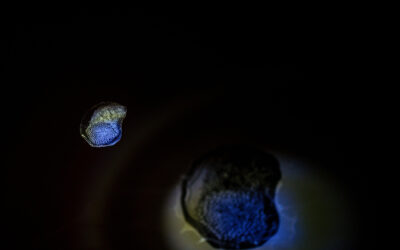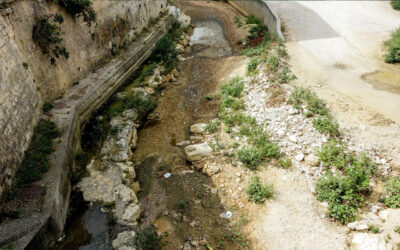„Sollte der britische Finanzsektor in der Post-Brexit-Welt florieren, und das ist unser Plan, wird er sich nicht auf das zehnfache BIP, er wird sich in einem Vierteljahrhundert auf das fünfzehn- bis zwanzigfache BIP belaufen.“
(Mark Carney, Governor der Bank of England, 03.08.2017)
Leben wir in einem parasitären System?
Ältere Volks- und auch andere Wirte werden sich erinnern, dass der Finanzsektor in früheren Zeiten nur eine Mittlerrolle spielte und dass die Spar- und Kreditinstitute nicht in den Berechnungen der produzierten Güter und Dienstleistungen auftauchten. Somit wurde dem Finanzsektor eine dienende Funktion zugewiesen. Für die Berechnungen des damaligen Bruttosozialproduktes wurde der Finanzwirtschaft gerade mal die Rolle als „Vorleistungssektor“ zugestanden. Eine eigentliche Wertschöpfung fand in diesem Sektor nicht statt. Dies begann sich in den 1970er Jahren zu ändern und der Finanzsektor wurde zunehmend in die Berechnungen des Bruttosozialproduktes aufgenommen. Dann kam die neoliberale Wende der 1980 er Jahre, das wachsende Bruttoinlandsprodukt wurde populär und man sprach zunehmend von „Finanzprodukten“. Die Änderung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ging einher mit einer beispiellosen Deregulierung des Finanzmarktes. In der Folgezeit kaperte die neoliberale Ökonomie zunächst die Hochschulen, dann die Schulen und danach die Lehrbücher. Es tauchte ein neuer, moderner Begriff auf und er wurde zur vorherrschenden Perspektive der ökonomischen Seminare – Shareholder-Value. „Im Verlauf dieses Prozesses verwechselt man Renten (unverdientes Einkommen) mit Profiten (verdientem Einkommen)“[1] und „Rent-Seeker“ wurden zunehmend belohnt, während echte „Wohlstandsschöpfer“ auf der Strecke blieben.
Rückkauf von Aktien
Ich möchte den Zusammenhang mit dem Rückkauf von Aktien verdeutlichen, weil man an dieser Stelle die Fehlentwicklung zwischen Real- und Finanzwirtschaft gut aufzeigen kann. In meiner Schul- und Studienzeit habe ich gelernt, dass Aktiengesellschaften Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, um wichtige Investitionen zu finanzieren. Heute wird das Geld vielfach für Dividenden und Aktienrückkäufe verwendet. Warum ist das so? Beginnen wir zunächst lehrbuchmäßig. Dabei wird klar, dass die neoliberale Wirtschaftspolitik mittlerweile fest im Lehrplan und auch in den Köpfen der Ökonomen verankert ist.
Positive Nachrichten
Aktionäre sind häufig erfreut, wenn eine Aktiengesellschaft einen Aktienrückkauf ankündigt. Durch den Rückkauf signalisiert die Unternehmung, dass sie die eigenen Aktien für eine gute Wertanlage hält. Die Aktionäre glauben, dass der Vorstand die Perspektiven des Unternehmens realistisch einschätzen kann und dass damit auch eine optimistische Zukunft bevorsteht. Also wird sich die Nachfrage erhöhen und die Aktienkurse werden steigen. Außerdem wird durch den Aktienrückkauf die Eigenkapitalquote sinken. Hierbei ist es unerheblich, ob die Aktiengesellschaft den Aktienrückkauf auf Kredit oder mit Barmitteln bestreitet. Sicher ist aber, dass es in der Regel eine höhere Dividende gibt, weil ja weniger Aktien im Umlauf sind.
Buchungstechnisch ist der Sachverhalt sehr einfach darzustellen: die Aktionäre bekommen Geld, die Aktiengesellschaft gibt Geld aus, natürlich den gleichen Betrag. Von einer Wertschöpfung kann also keine Rede sein. Da aber die Dividende gestiegen ist, ist der Aktienrückkauf für die Manager dieser Unternehmung mit einer Erhöhung der Vergütung verbunden. Da der Erfolg einer Aktiengesellschaft mit den Gewinnen in Beziehung gesetzt werden und die Manager, unsere sogenannten „Leistungsträger“[2], häufig am Ergebnis beteiligt werden, wird ein Aktienrückkauf als Erfolg gefeiert und die Vorstände kassieren kräftig mit. Diese Kapitalstrategie ist aber nichts anderes als die exzessive Verteilung von Profiten, die als die Maximierung des Shareholder-Value vergöttert werden.
Wie funktionieren Aktienrückkäufe
Zunächst benötigt der Vorstand einen Beschluss der Hauptversammlung, dass er eigene Aktien kaufen darf. Diese Ermächtigung ist allerdings begrenzt: Maximal 10 Prozent des Grundkapitals kann die Aktiengesellschaft mit solch einem Beschluss, der fünf Jahre gilt, erwerben. Fast alle in Deutschland börsennotierten Unternehmen lassen sich eine solche Ermächtigung „auf Vorrat“ auf der jährlichen Hauptversammlung geben. Diese Ermächtigung wird häufig von den Vorständen mit der wohlklingenden Floskel „Kurspflege“ bezeichnet. Warum? Nach Paragraph 71 b des Aktiengesetzes stehen der Gesellschaft keine Rechte aus eigenen Aktien zu. Zukünftige Gewinne und Dividenden verteilen sich dann auf wenige Anteilsscheine und das Kurs-Gewinn Verhältnis sinkt. So weit, so Binse, so Lehrbuch.
Ein Beispiel des US-amerikanischen Konzerns Apple verdeutlicht die Situation: „Im Jahre 2018 gaben die 3.000 größten US-Unternehmen über eine Billion Dollar aus, um eigene Aktien zurückzukaufen. Allein Apple nahm von 2014 bis 2018 ziemlich genau jede fünfte Aktie vom Markt – Kostenpunkt 2018: 70 Mrd. Dollar. Wozu das gut sein soll? Einmal steigt der Aktienkurs. Gleichzeitig sinkt das Eigenkapital der Firmen. Das erhöht den Profit pro Aktie.“[3] In Amerika wurde zwischen 2003 und 2012 über 2,4 Billionen Dollar für den Rückkauf von Aktien ausgegeben.[4] Dieses Finanzgebaren mag für den einzelnen Aktionär oder auch für die Aktiengesellschaft vorteilhaft sein, es ist aber volkswirtschaftlich gefährlich und muss deshalb kritisiert werden.
Kritik an Aktienrückkäufen
Aktionäre und Anleger werden bei Aktienrückkäufen bei Laune gehalten. Diese Art von „Kurspflege“ erzeugt aber keinen ökonomischen Mehrwert und es findet keine ökonomische Investition statt. Im Gegenteil, der Aktiengesellschaft wird später Geld fehlen, wenn es um neue Projekte, etwa die Anschaffung von Maschinen oder Forschungsvorhaben, geht. Kurzfristige Aktienrückkäufe reduzieren langfristige Investitionen, dies wird zu Produktivitätsverlusten führen. Auch in Krisenzeiten, siehe Corona-Krise, könnte den Vorständen das Geld fehlen, dabei haben wir die Finanzkrise aus dem Jahre 2008 noch lange nicht überwunden. Durch halbherzige Reformen wurde das Finanzsystem nicht stabilisiert und die Eigenkapitalquoten der Spar- und Kreditinstitute befinden sich noch immer auf einem niedrigen Niveau. Aktienrückkäufe tragen ebenfalls dazu bei, dass viele Geldhäuser eine Fremdkapitalquote von über 95 Prozent haben. Die Geschäftsmodelle vieler Akteure haben sich seit der Finanzkrise nicht signifikant geändert. To big to fail scheint immer noch zu gelten und man möchte mit Neil Young ergänzen – and to rich for jail.
Fazit
Volkswirtschaftlich ist nachweislich die Schere zwischen arm und reich seit der neoliberalen Wende der 1980er Jahre sehr stark auseinandergegangen. Natürlich lässt sich dieses Phänomen einerseits über eine mangelnde Gerechtigkeit und andererseits über unfaire Verdienstmöglichkeiten erklären. Man mag beklagen, dass ein Jeff Bezos von Amazon in 16 Sekunden[5] genauso viel verdient wie ein Krankenpfleger in einem Monat. Dies ist sicherlich richtig. Volkswirtschaftlich ist es aber mittlerweile sehr problematisch, dass die Geldmassen der Superreichen nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten sucht. Dies könnte das gesamte System bedrohen, weil die reale Nachfrage bei rückläufigen Steuereinnahmen sinkt. Deshalb gilt – die Finanzwirtschaft dient nicht der „realen“ Wirtschaft, sondern sich selbst und „Shareholder-Value [ist] die dümmste Idee der Welt“ (Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric, 2009).
[1] Mariana Mazzucato, Wie kommt der Wert in die Welt?, Frankfurt/New York, 2018, S. 17
[2] In diesem Fall wurde aber keine Leistung erbracht, es wurde lediglich umverteilt.
[3] Gerhard Schick, Die große Verdrängung, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 1`21, Berlin, 2021, S. 101
[4] Vgl. Mariana Mazzucato, Wie kommt der Wert in die Welt?, Frankfurt/New York, 2018, S. 219
[5] Auch diese Zahl stimmt vermutlich nicht mehr. Angeblich „verdient“ Jeff Bezos pro Sekunde soviel wie ein Krankenpfleger in einem Monat.