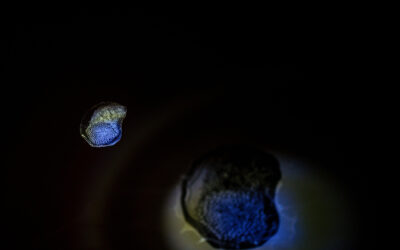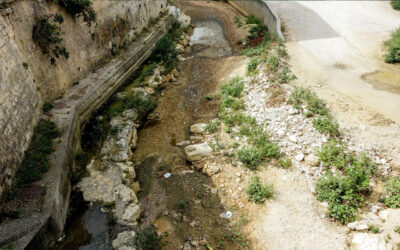„Man müsste sich die Unbestechlichkeit bezahlen lassen.“
(Werner Schneyder)
Die Corona-Krise offenbart ein extrem hohes Maß an Ungleichheit. Die ärmere Bevölkerung leidet wesentlich stärker als der reichere Teil. Dieser Sachverhalt wurde auch in der Zeit der Spanischen Grippe im Jahre 1918 deutlich: in den USA und in Europa starben noch nicht einmal 1 Prozent der Bevölkerung, während in Indien 6 Prozent der Bevölkerung mit dem Leben bezahlen mussten.
Seitdem der französische Ökonomieprofessor Thomas Piketty das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert veröffentlicht hat, wird folgende Grundthese in der Ökonomie diskutiert: Solange Einkommen aus Vermögen schneller wächst als Einkommen aus Arbeit, muss die Ungleichheit zwangsläufig zunehmen. Dieses ist schon seit den 1980er Jahren in Westeuropa zu beobachten. Außerdem sorgte, nach Thomas Piketty, das Regime des freien Kapitalverkehrs der 1980er und 1990er Jahren dafür, dass die Steuerhinterziehung durch Millionäre und multinationaler Unternehmen explosionsartig zunahm. Auch setzte ein Steuerwettbewerb ein, der arme Länder daran hinderte, ein gerechtes Steuersystem zu entwickeln, mit der Konsequenz, dass diese Länder keinen funktionierenden Sozialstaat aufbauen konnten. In den reicheren Ländern führte der Steuerwettbewerb zu einem Abbau des Sozialstaates.
In einer Talkshow vertrat der FDP-Politiker Christian Lindner die Auffassung, dass der deutsche Staat sich dem internationalen Steuerwettbewerb stellen müsse. Dies klingt so, als wenn der Steuerwettbewerb ein Naturgesetz wäre. Ökonomische Sachverhalte sind aber keine Naturgesetze, sie sind immer anthropogen, also menschengemacht. Insofern lässt sich der Wettbewerb um die geringsten Steuern auch ändern. Wie ist nun dieser Steuerwettbewerb entstanden?
Die Reaganomics
Der Schauspieler Ronald Reagan hat als amerikanischer Präsident der 1980er Jahren die Wirtschaftsform Reaganomics für sich entdeckt und somit das Eigeninteresse über das Allgemeinwohl gestellt. Ronald Reagan war der amerikanische Türöffner, der die neoliberale Wirtschaftspolitik erst ermöglicht hat; auf britischer Seite war es Margaret Thatcher, die im Mai 1979 zur Premierministerin gewählt wurde. Sie formulierte: »there is no alternative« und meinte, dass es keine Alternative zur neoliberalen Welt gibt. Während vorhergehende Regierungen auf nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ausgerichtet waren, vollzog Reagan den Wechsel zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, das war das Ende des Keynesianismus. Ziel war es, die Produktions- und Wachstumsbedingungen der Anbieter zu stärken. Dieses wirtschaftliche Prinzip basiert auf der sogenannten Trickle-Down-Theorie, die davon ausgeht, dass wohlhabende Schichten der Bevölkerung den Wohlstand an untere Gesellschaftsschichten weitergeben; es handelt sich hier um einen »Durchsickerungseffekt.« Wohlstandsstiftende Effekte werden weitergegeben an die Einkommensschwachen. Man muss die Wohlhabenden immer reicher machen, dann bleiben noch die letzten Brotkrümel für die Armen übrig. Eine sozialstaatlich geleitetete Umverteilungspolitik ist in diesem Fall nicht mehr erforderlich.
Das neue Steuereinmaleins
Der weltweite Steuerwettbewerb setzte am 22. Oktober 1986 mit dem Erlass des Tax Reform Act ein. Ronald Reagan verfügte darin, dass der amerikanische Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer von über 70 Prozent auf 28 Prozent gesenkt wurde. Auch wenn dieses Steuergeschenk in der amerikanischen Bevölkerung nicht sonderlich populär war, schlug eine Welle der Begeisterung bei den Multimillionären und internationalen Konzernen ein. „Der Tax Reform Act vom 1986 veranschaulicht damit exemplarisch, wie ein System progressiver Besteuerung stirbt. Es geht nicht demokratisch zugrunde, es wird nicht vom Wählerwillen zerlegt, sondern es wird bewusst zugrunde gerichtet. Wenn man sich die meisten der größten Rücknahmen progressiver Besteuerung ansieht, stößt man stets auf ein bestimmtes Muster: Als Erstes nimmt die Steuerumgehung massiv zu. Dann folgt die Klage von Regierungen, die Reichen zu besteuern sei unmöglich geworden. Anschließend werden deren Steuersätze gekürzt.“[1]
Seit den 1980er Jahren begannen viele Staaten die Steuern massiv zu senken; die Spitzensteuersätze sind kontinuierlich nach unten korrigiert worden, in der Hoffnung, dass sich Selbstfinanzierungseffekte einstellen. Neoliberale Ökonomen glauben tatsächlich an solche Effekte. Jonathan Swift (1667–1745) beschrieb diesen Sachverhalt schon im Jahre 1728 in seinem sogenannten »Steuereinmaleins«: Wenn der Steuersatz sinkt, führt das zu höheren Gewinnen in den Unternehmen. Diese zusätzlichen Gewinne können dann für Investitionen genutzt werden. Die Folge ist ein Wachstum der Wirtschaft. Dadurch werden mehr Steuereinnahmen generiert »als durch die vorherige Steuersenkung verloren gehen«.[2] Diese wissenschaftlich umstrittene These wurde in den 1970er Jahren durch den US-Ökonomen Arthur B. Laffer finanzwissenschaftlich untersucht und in den 1980er Jahren durch Ronald Reagan wirtschaftspolitisch umgesetzt. Am Ende der Reagan-Ära stand die US-Administration vor einem enormen Berg von Schulden. Die Staatsschulden sind in Amerika explodiert. Die öffentlichen Haushalte erlitten massive Einnahmeverluste mit der Folge, dass das amerikanische Haushaltsdefizit von circa 600 Milliarden Dollar (1981) auf über 18.000 Milliarden Dollar (2017) angestiegen ist. Die These der neoliberalen Ökonomen, dass durch Steuersenkungen die Investitionsbereitschaft der Unternehmen zunimmt, kann wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Investitionen sind nur marginal von der Besteuerung und auch von der Höhe der Zinsen abhängig.
Weder Steuervergünstigungen noch geringe Zinsen sorgen für Investitionen. Es gibt nur einen betriebswirtschaftlichen Grund, der Investitionen begünstigt – die zu erwartenden Gewinne der Unternehmen. Kein Unternehmer der Welt tätigt eine Investition, weil die Steuersätze so schön niedrig sind. Wenn keine Gewinne zu erwarten sind, unterbleibt die Investition. Daran wird auch die Corona-Krise nichts ändern. Es wächst aber die Einsicht, sogar bei den Unternehmensverbänden, dass die Schuldenbremse eine marode gesparte Infrastruktur hinterlassen hat. Der Investitionsstau in der deutschen Volkswirtschaft ist beträchtlich. Wenn nun in der Corona-Krise Steuereinnahmen fehlen, müssen zwangsläufig Kredite aufgenommen werden. Jeder Hauseigentümer und Unternehmer weiß aus eigener Erfahrung, dass die Kreditaufnahme unproblematisch ist, solange nachhaltige Werte (z.B. Klimaschutz) geschaffen werden. Wenn die zukünftige Generation aus diesen Krediten mehr Nutzen ziehen könnte als Zins und Tilgung kosten, ist eine Verschuldung sinnvoll. Werthaltige Investitionen lassen sich problemlos über eine Verschuldung finanzieren. Jeder Ökonom kennt den sogenanten Leverage-Effekt, der erklärt, dass eine Fremdfinanzierung sogar absolut sinnvoll sein kann. Die neoliberale Forderung nach Steuerreduzierung und gleichzeitigem Abbau der Staatsverschuldung entspringt allerdings einer sehr naiven ökonomischen und gesellschaftspolitischen Denkweise.
[1] Emmanuel Saez und Gabriel Zucman, Wie die Ungerechtigkeit triumphierte, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Berlin, 06/20, 2020, S. 58/59
[2]Rudolf Hickel in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Berlin, Juni 2017, S. 59