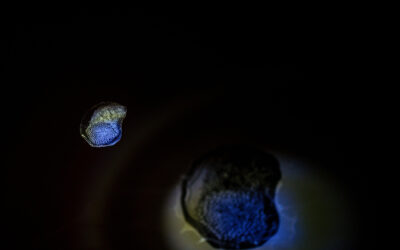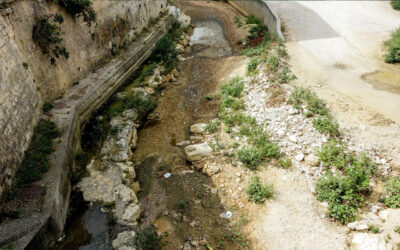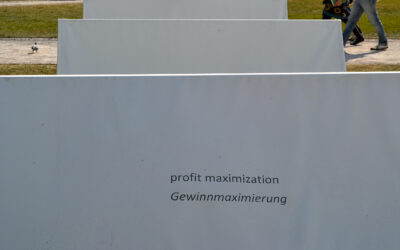Man kennt ja den Unterschied zwischen Gott und einem Ingenieur – Gott glaubt nicht, dass er ein Ingenieur ist.
Vielleicht treffen die Heilsversprechen des Silicon-Valleys und der technikgläubigen Politikerinnen und Politiker zu. Der Mensch hat durch die Künstliche Intelligenz eine rosige Zukunft, die Arbeit wird leichter und wir werden, bei vollem Lohnausgleich, mehr Freizeit haben. Der technische Fortschritt wird den Klimawandel aufhalten, die Ressourcen schonen und die Unsterblichkeit der Menschen steht vor der Tür. An solch einen Hokus Pokus mag ich nicht glauben. Zumal die Künstliche Intelligenz vor allem eines ist: ein exorbitanter Energiefresser, der wahrscheinlich zum Klimakiller Nr. 1 mutieren wird. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen warnte schon im Jahr 2019 vor der Digitalisierung als Klima- und Umweltretter. Der Beirat bezeichnete die Digitalisierung als »Brandbeschleuniger bestehender, nicht nachhaltiger Trends«.
Ein berühmtes Zitat von Albert Einstein lautet: »Die Definition von Wahnsinn ist: immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.« Da sind Algorithmen ganz anders – sie tun immer wieder das Gleiche und die Ergebnisse sind auch immer die Gleichen. Die Determiniertheit der Algorithmen besteht also darin, dass sie bei denselben Voraussetzungen das gleiche Ergebnis liefern. Die Künstliche Intelligenz bedient sich ebenfalls Algorithmen, um vorgegebene Probleme zu lösen. Die KI greift zusätzlich auf einen Vorrat zuvor erlernten Wissens zu. Mit dieser Wissensgrundlage können geeignete Algorithmen geschriebene und gesprochene Sprache verarbeiten, Texte formulieren und Gesichter oder Objekte identifizieren. Wo nimmt die KI nun dieses Wissen? Klar, aus dem Internet, dass von Milliarden von Menschen mit Daten versorgt wird. Das Internet hält zwar jede Menge Wissen vor, gebildet ist es aber nicht. Und wenn es um kritische Auseinandersetzungen eines Sachverhaltes geht, gibt es, neben den Mainstreammeinungen, sehr polarisierende Auffassungen. Differenzierte Grautöne scheinen gefühlt auf dem Rückmarsch zu sein. Der substanziell kritische Diskurs ist im Internet eher eine Randerscheinung.
Mit zunehmender Implementierung der KI scheint sie in vielen Bereichen unverzichtbar. Beispielsweise im medizinischen Sektor leistet sie hervorragende Arbeit, solange Strom vorhanden ist. Sicher ist, dass die Künstliche Intelligenz bei einem Stromausfall sofort zu einhundert Prozent dumm sein wird. Ich möchte an dieser Stelle auch keine Beurteilung über die KI abgeben, sondern nur einige kritische Anmerkungen äußern. Es ist kaum möglich, die KI oder die Digitalisierung in ein »gut oder schlecht«-Schema zu pressen. Genauso könnte man fragen, ob die Mathematik gut oder schlecht ist. Es geht weder darum, die technologische Entwicklung abzulehnen, noch geht es darum, alles, was technisch möglich ist zu befürworten. Vielmehr müssen die Bedingungen dieser Entwicklung hinterfragt und der Verwertungsimperativ der Digitalisierung aufgedeckt werden. Sämtliche Technologien sind offene Systeme. Dadurch können sie von Menschen vielfältig, vielseitig und in viele Richtungen und Ausprägungen genutzt werden. Im Rahmen der Digitalisierung sind nicht die Maschinen, die uns angeblich die Arbeit wegnehmen, zu verurteilen, sondern das betriebswirtschaftliche Kalkül kostensparend zu produzieren. Menschen werden als Kostenfaktoren in den Kalkulationen geführt und sie sind nur dann zu gebrauchen, wenn sie günstiger sind als die Maschinen. Über dieses Kalkül lässt sich hingegen vortrefflich streiten.
Auch die Ausführungen von Erich Fromm vor über 50 Jahren sind für den gegenwärtigen Diskurs nützlich. Er bezog sich damals auf den amerikanischen Wissenschaftler Lewis Mumford, der den Ausdruck der »Megamaschine« prägte. »Er meint damit eine neue Form der Gesellschaft, die sich so radikal von der bisherigen Gesellschaft unterscheidet, dass die Französische Revolution und die Russische Revolution im Vergleich zu dieser Veränderung verblassen: eine Gesellschaftsordnung, in der die Gesamtgesellschaft zu einer Maschine organisiert ist, in der das einzelne Individuum zum Teil der Maschine wird, programmiert durch das Programm, das der Gesamtmaschine gegeben wird. Der Mensch ist materiell befriedigt, aber er hört auf zu entscheiden, er hört auf zu denken, er hört auf zu fühlen und er wird dirigiert von dem Programm. Selbst jene, die die Maschine leiten – das muss man hinzufügen – werden vom Programm dirigiert.«[1] Da sind sie wieder, die akkumulierenden »Charaktermasken« (Karl Marx).
Halleluja, der Mensch ist fehlerbehaftet
Weltweit wollen Tech-Unternehmen eine Menge Geld verdienen, und das gelingt logischerweise mit Hilfe des technischen Fortschritts. Ingenieure und Informatiker arbeiten seit jeher mit viel Enthusiasmus an die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Das ist die Religion der Ingenieure des Silicon Valley. Ob Gott nun den Menschen erschaffen hat, oder der Mensch Gott, ist nebensächlich. Entscheidend ist die Aussage: nach seinem Ebenbild. »Gott ist eine Metapher für die menschliche Gattung. Alles, was ihm zugeschreiben wird, sind tatsächliche Attribute der Gattung.«[2] Es wird weniger gefragt, was für den Menschen gut und sinnvoll ist, sondern das technisch mögliche wird vollzogen.
Die Ingenieure und der technische Fortschritt wollen gottesgleich den Menschen in eine funktionierende Maschine verwandeln. Das Resultat ist: »Die Dinge werden vermenschlicht, die Menschen verdinglicht.«[3] Die Optimierung und die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit wird human enhancement genannt und sie treibt den Kapitalismus an. Politikerinnen und Politiker begreifen häufig die Künstliche Intelligenz als große Zukunftschance und setzen sie mit der industriellen Revolution vor über 250 Jahren gleich. Ob es sich damals um eine Revolution im eigentlichen Sinne gehandelt hat, darf getrost bezweifelt werden. Es war wohl eher eine Domestizierung und eine rücksichtslose Ausbeutung der Männer, Frauen und Kinder. Diese industrielle Revolution wurde auch nicht von Arbeiterinnen und Arbeiter organisiert, sondern eher von Unternehmen initiiert. Das Volk musste diese Art von Revolution ungefragt ertragen. Da die industrielle Revolution heutzutage als selbstverständlich hingenommen wird, scheint eine weitere Klärung nicht erforderlich. Um nicht der Versuchung zu unterliegen, die industrielle Revolution zu verherrlichen und mit der digitalen Revolution gleichzusetzen, lohnt sich ein Blick auf die Marxsche Theorie.
Wenn sich ein wesentlicher Wandel der Produktionsverhältnisse ergibt, ist dies nicht nur eine ökonomische Umwälzung, sondern der Veränderungsdruck trifft die gesamte Gesellschaft. Hierbei spielen die Eigentumsverhältnisse eine wesentliche Rolle. Beispielhaft sei der selbstständige Handwerker erwähnt, der mit seinen eigenen Werkzeugen, den Produktionsmitteln, fertige Produkte herstellt, die er wiederum auf eigene Rechnung verkaufen kann. Werden im Rahmen einer technischen Innovation industrielle Produkte günstiger angeboten, kann der Handwerker nicht mehr mithalten, er ist nicht mehr konkurrenzfähig. Bedingt durch das Gesetz der Massenproduktion und der zunehmenden digitalisierten Arbeitsteilung gehen die Preise nach unten und der Handwerker verliert im schlimmsten Fall seine Existenzgrundlage. Somit ist er gezwungen seine Arbeitskraft an den Industriebetrieb zu verkaufen. Die Fabrikbesitzer, Anteilseigner und Investoren denken profitorientiert und der Arbeiter hat keinen Einfluss auf die Produktionsmittel. Auch das fertige Produkt ist ihm fremd. Somit wird er seiner früheren Verfügungsgewalt beraubt und seine Arbeit wird degradiert. Er ist nun vollständig abhängig vom Unternehmer und das hat gesamtgesellschaftliche Folgen, die soziale, politische, finanzielle und ökologische Verhältnisse tiefgreifend verändern. Es entstehen zyklische Krisen der Überproduktion und eine tiefgreifende Abhängigkeit von wachstumsorientierten und eindimensionalen KI- und Digitalunternehmen, die uns zusätzlich die Gehirne waschen, uns internetsüchtig machen und exorbitante hohe Profite generieren .
Die KI ist nur ein gefährliches Geschäftsmodell
Mit der Künstlichen Intelligenz soll nun wieder eine Industrierevolution stattfinden. Die digitale Revolution ist aber überhaupt keine Revolution, sie ist lediglich ein Geschäftsmodell der Tech-Branche. Auch diese Revolution wird nicht von Arbeiterinnen und Arbeitern und auch nicht vom Volk initiiert, sondern die Tech-Unternehmen treiben sie, mit aller Macht, voran. Eine Ausweitung der Macht von Menschen über Menschen führt zwangsläufig zu einer Ohnmachtserweiterung der Menschen, die dieser Macht schutzlos ausgeliefert sind. Anstatt Machtstrukturen zu analysieren, wird diese industrielle Revolution einseitig glorifiziert und es wird medial dafür gesorgt, dass sich Menschen keine andere Gesellschaft vorstellen können als die, die es schon gibt. Dabei ist die Anzahl der Alltagsprobleme mit der zunehmenden Digitalisierung gestiegen. »Den größten Teil des Tages lösen Menschen keine Probleme, indem sie Schmerzen minimieren und Belohnungen maximieren. Welches Problem wird gelöst, wenn ich einen Film anschaue? Welches, wenn ich mich an den schönen Abend gestern mit Freunden erinnere?«[4] Begriffe wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz lassen sich deshalb kaum positiv bestimmen, sie müssen kritisch hinterfragt werden. Wobei es durchaus viele positive digitale KI-Anwendungen gibt.
Richtig problematisch wird es aber, wenn sich die Tycoons des Silicon Valley auch noch die Deutungshoheit über die neuen Technologien verschaffen und lebende Organismen nicht als etwas Besonderes, Einzigartiges oder gar Heiliges begreifen. Technik-Utopisten hängen eben »nicht besonders an Menschen, das ist ein Grund, warum sie sich keine Sorgen um den Verlust der Bedeutung des Menschen machen.«[5] Wenn es nach den Willen der Künstlichen Intelligenz geht, sollen Menschen jegliche Art von Bindungen, auch Traditionsbindungen, überwinden, «das heißt, die Menschen flexibler und besser verwendbar zu machen.«[6] Dabei ist es doch ein besonderes Merkmal von Menschen. dass sie glücklicherweise fehlerhaft sind. Und da ist die Krux: Die Funktion von KI ist es, Fehler auszumerzen. Menschen lernen aus Fehlern. Indem wir stolpern und wieder aufstehen, mit Konfrontationen und Widerständen umgehen und kritikfähig bleiben erfahren wir die Welt. Wir benötigen die Resonanz, um die Welt zu erfahren und zu gestalten.
Auch wird die Herrschaft der Algorithmen uns in naher Zukunft die Finanzwirtschaft komplett verändern. Früher war es doch so: Wenn man auf dem Sparbuch 3 Prozent Zinsen bekam, verdoppelt man in dreißig Jahren sein Sparvermögen. Solche Sachverhalte wurden als normal angesehen, eine Kritik war auch nicht nötig. Schließlich wurden Sparer in der damaligen Volkswirtschaft benötigt, um die Unternehmen mit Geld zu versorgen. Lang, lang ist es her. Der heutige Hochfrequenzhandel an den Börsen dieser Welt zeichnet aber ein vollkommen anderes Bild. »[W]enn man auf dem Finanzmarkt 3 Prozent pro Nanosekunde[i] bekommt, dann hat man in einer Mikrosekunde so viel wie der Sparer in 1.000 Jahren bekommen hat. Dieser Nanosekundenhandel hat die Zeitskala einer Atombombe und entsprechend wirkt er.«[ii] Dieser explosionsartige Handel, der durch die KI exorbitant beschleunigt wird, kann, noch nie dagewesene, Finanzkrisen auslösen. Sie wird auch die Schere zwischen arm und reich vergrößern. Es wird schwer werden, die KI nur als Hilfsmittel einzuhegen. Vielleicht wird sie sogar zum bestimmenden Element.
[i] Eine Nanosekunde entspricht 0,001 Mikrosekunden.
[ii] Anders Levermann im Interview, WIR VERBIETEN NICHT FLIEGEN, SONDERN CO2-AUSSTOSS, in Futur Zwei, Magazin für Zukunft und Politik, Berlin, 12.12.2023, S. 61.
[1] Erich Fromm, Humanismus in Krisenzeiten, München, 2025, S. 145/146.
[2] Guillaume Paoli, Geist und Müll, Von Denkweisen in postnormalen Zeiten, Berlin, 2023, S. 212.
[3] Guillaume Paoli, Geist und Müll, Von Denkweisen in postnormalen Zeiten, Berlin, 2023, S. 218.
[4] Richard David Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, München, 2020, S. 135.
[5] Bill McKibben, Die taumelnde Welt, München, 2019, S. 245.
[6] Oskar Negt, Der Politische Mensch, Göttingen, 2010, S. 67.