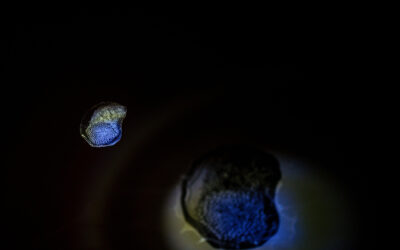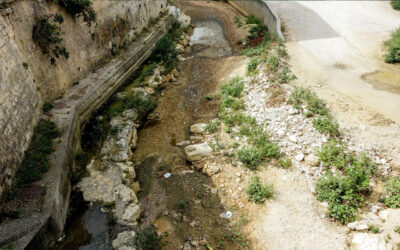„Wir (müssen) immer schneller laufen (…), um unseren Platz in der Welt zu halten.“ (Hartmut Rosa)
In meinem vorletzten Blog habe ich die Externalitätsgesellschaft beschrieben und festgestellt, dass der Ursprung im Kolonialismus zu finden ist. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert veränderten sich die institutionellen Ordnungen und es fand eine gewaltige Dynamisierung der Gesellschaft statt.
Die Ökonomie war vorher geprägt durch bedarfsorientiertes und bedarfsdeckendes Wirtschaften. Ab dem 17. Jahrhundert war die nun kapitalistisch orientierte Ökonomie darauf angewiesen, den Kapitalzirkulationsprozess ununterbrochen in Gang zu halten. Mehr noch – er musste sogar beschleunigt werden, sodass die materielle Wachstumsspirale permanent vorangetrieben wurde. Diese Zirkulation nahm Karl Marx zum Anlass, den dynamischen Steigerungsprozess mit seiner berühmten Formel, G – W – G`, zu beschreiben. Im Gegensatz zum bedarfsorientierten Wirtschaften kommen nun ökonomische Prozesse nur dann in Gang, wenn es eine realistische Aussicht gibt, das eingesetzte Kapital zu vermehren. Dies geschieht, weil die Natur zum Objekt der Kapitalakkumulation geworden ist. Marx spricht von der „Inwertsetzung der Natur“. Sie wird vermessen, in Einzelteile aufgeteilt und es werden Eigentumsrechte definiert und durchgesetzt. Alle materiellen Waren kommen als Rohstoffe aus der Natur. Die Waren spielen aber im Kapitalakkumulationsprozess nur eine untergeordnete Rolle, sie fungieren nur als Mittler für die Akkumulation, die durch permanente Investitionen angetrieben wird. Der Systemzweck des Kapitalismus besteht keineswegs in einer guten Güterversorgung und einem sorgsamen Umgang mit der Natur, sondern nur darin, aus Geld (G) mehr Geld (G`) zu machen.[1] Das für die Warenproduktion eingesetzte Kapital muss vermehrt werden. Der Überfluss und die Vernichtung von Waren spielen nur dann eine Rolle, wenn sie der Kapitalakkumulation dienen. Marx entwickelte aus diesen Erkenntnissen das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Er folgerte daraus, dass der Sinn des Kapitalismus nicht die Warenproduktion für den Bedarf der Gesellschaft sei, sondern der Profit. Dieser Widerspruch bewirke, dass das System immer wieder aus dem Gleichgewicht gerate.
Eine weitere konstitutive Dimension ist die Akkumulation von politischer Macht. Unternehmen wie Google, Facebook, Apple und Amazon agieren nicht auf Märkten, sie sind die Märkte. Insofern hat sich die ökonomische Macht tendenziell mit der politischen Macht verzahnt. „Ob es um Freihandelsabkommen oder Arbeitsmarktreformen, um Geopolitik oder Bildung, Steuersystem oder Forschungsförderung geht: „Der Zwang, steigerungsfähig zu bleiben oder zu werden, trifft spätmoderne Regierungen so unmittelbar, dass dahinter weltanschauliche, kulturelle oder genuin politische Gegensätze verblassen. Linke wie rechte, grüne wie liberale, konservative wie progressive und europäische wie amerikanische oder asiatische Parteien und Regierungen unterliegen, dem durchgreifenden Imperativ des Steigerungszwangs.“[2] Es ist vollkommen egal, wie aktiv oder kreativ wir sind, wie schnell oder beweglich wir in diesem Jahr sind, fest steht jetzt schon, dass wir uns im nächsten Jahr steigern müssen. Wann stößt dieser systemimmanente Beschleunigungs- und Optimierungswahn an seine Grenzen?
Früher war alles anders
Die bedarfsorientierte Ökonomie früherer Tage hat Geld einfach als Tauschmittel angesehen, sodass die Formel, W – G – W, zur Geltung kam. Ware (W) wurde in Geld (G) getauscht um dann wieder Ware (W) zu kaufen. Es gab demzufolge keine dynamischen Steigerungslogik, kein Wirtschaftswachstum und somit keine übermäßige Naturausbeute. Diese Illusion wird heute noch gerne mit dem Begriff „Marktwirtschaft“ verknüpft, denn dieser Terminus erweckt den Eindruck, dass immer noch urmenschliche Tauschaktivitäten stattfinden. Im Gegensatz zum Kapitalismus hat es Märkte zu allen Zeiten und in unterschiedlichen Gesellschaften gegeben. Mit dem Kapitalismus kam aber „die schicksalsvollste Macht unseres modernen Lebens“[3] in die Welt, das Leben wurde „auf ständige Optimierung, Rationalisierung und Effizienzsteigerung hin ausgerichtet“[4] und mit den zunehmenden Verdinglichungs-, Ausbeutungs- und Entfremdungsprozessen rückte die Externalitätsgesellschaft immer näher. Wie ich im vorhergehenden Blog ausgeführt habe, wird in der heutigen Zeit die Externalitätsgesellschaft als „normale“ Gesellschaftsform angesehen. Die Grundlage dafür bildete der britische Philosoph John Locke, der die Einrichtung des Privateigentums als Fundament der Gesellschaft betrachtete und der Ökonom Adam Smith, der „die ungehemmte Entfaltung der gesellschaftlichen Kapitals- und Reichtumsakkumulation“ (Hannah Arendt, Vita aktiva) befürwortete. Adam Smith war der Auffassung, dass der so geschaffene Reichtum allen zugutekommt, die zweifelhafte Trickle-down-Theorie und die Laffer-Kurve wurden somit fester Bestandteil der klassischen Volkswirtschaftslehre.
In der heutigen Zeit wird die kapitalistische Normalität, also das sich ständig selbst ausweitende Kapital, ebenfalls untersucht. Beispielsweise fand Oxfam heraus, dass die reichsten Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, das sind 3,8 Milliarden Menschen, besitzen. Vor fünf Jahren zählte die reichste Seite der Menschheit noch 366 Menschen, heute sind es nur noch 62. Die These von Marx, wonach der kapitalistischen Akkumulation eine zunehmende Konzentration innewohnt, scheint längst bewiesen zu sein. Auch der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat in seinem bahnbrechenden Werk, Das Kapital im 21.Jahrhundert, im Jahre 2014 statistisch untermauern können, dass die Kapitalrendite tendenziell[5] die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate übersteigt. Damit werden gesellschaftliche Verteilungsspielräume erheblich eingeengt und die Gewinne aus Kapitalbesitz, oder sollte man besser Renten sagen, führen zu einem einseitigen Wohlstandszuwachs für die Wohlhabenden. Die Haushalte mit geringeren Einkommen haben das Nachsehen und die Trickle-down-Theorie wurde entkräftet. Denn nach Thomas Piketty führt die Logik eines nicht regulierten Kapitalismus dazu, dass Einkommens- und Vermögensungleichheiten stetig zunehmen werden. Dieser Befund wird inzwischen auch von der OECD geteilt.
Fazit
Die Steigerungsimperative werden so lange weiter bestehen, wie sich die Gesellschaft und insbesondere die produzierende Wirtschaft nach der Formel G – W – G` ausrichtet. Solange sich die Kapitalakkumulation ausschließlich auf Profit, Gewinn und Rendite kapriziert, wird sich daran nichts ändern. Gewinne zu internalisieren und Risiken zu externalisieren ist kein nachhaltiges und tragfähiges Konzept. Die Konsumenten werden von einem Konsumakt zum nächsten getrieben und die Warenbeziehung ist eine Beziehung der Beziehungslosigkeit.[6] Ungleiche Tauschverhältnisse ergeben sich aber nicht von allein, sie sind anthropogen. Das kapitalistische System ist nicht auf die Befriedigung von Bedürfnissen ausgelegt, sondern auf die Erzielung von Mehrwert, der durch die Ausbeutung der Natur geschaffen wird; daran wird auch der digitale Kapitalismus nichts ändern. Eine Transformation von der Externalitätsgesellschaft[7] hin zu einer Postwachstumsgesellschaft wird aber so oder so stattfinden müssen, da die Ressourcenbasis „Natur“ der kapitalistischen Akkumulation unaufhörlich schrumpft. Auch die Ressourcenbasis „Mensch“ verkleinert sich immens, weil weltweit immer weniger Menschen gefunden werden, die sich in die internationale Arbeitsteilung einbinden können, um die Massenproduktion zu gewährleisten. In der westlichen Welt stößt der Kapitalismus an seine physischen Grenzen und Wachstum wird zunehmend an den Finanzmärkten, durch massive Kreditaufnahme und Geldvermehrung durch die Zentralbanken, erzeugt. Über kurz oder lang wird auch die Belastbarkeit der Natur an systematische Grenzen stoßen und „(je) länger wir uns weigern, die Notwendigkeit einer Reduktionsstrategie anzuerkennen, desto wahrscheinlicher werden Krisen, die uns vor sich hertreiben und uns genau jene Anpassungen abverlangen, die Teil einer Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie sind.“ (Niko Paech)
[1] In den letzten Tagen und Monaten erinnere ich mich wieder häufiger an die Weisheit der Cree: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluß vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.“ Auch wenn der Ursprung wissenschaftlich nicht geklärt ist, war diese Weissagung in 1970–iger Jahren sehr populär.
[2] Rosa, Hartmut, Resonanz, Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin, 2020, S. 710
[3] Weber, Max, Die protestantische Ethik, Gütersloh, 1991, S.12
[4] Rosa, Hartmut, Resonanz, Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin, 2020, S. 680
[5] Marx ging von einer tendenziell fallenden Profitrate aus. Er konnte damals natürlich nicht vorhersagen, dass wir es im 21.Jahrhundert mit einem total entfesselten, privatisierten und kaum regulierten Finanzmarkt zu tun bekommen.
[6] Vgl. Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Spätmoderne in der Krise, Berlin, 2021, S.247
[7] „[D]as doppelte Handlungsprinzip des Externalisierens [lautet]: Man tut es, weil man es kann – und weil man nicht anders kann. Man verlagert die Kosten des eigenen Handelns auf andere, weil man dazu in der Lage ist – bzw. weil man gesellschaftlich dazu in die Lage versetzt wird. Man lässt Dritte für das eigenen Wohlergehen zahlen, weil man sich in einer gesellschaftlichen Position befindet, die ebendies erlaubt.“ (Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut, München, 2020, S. 59)